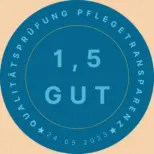Fragen und Antworten
Leistungen
Fragen und Antworten
Was zahlt die Pflegekasse?
Die Pflegeversicherung
Was ist die gesetzliche Pflegeversicherung?
Die Pflegeversicherung ist eine Pflichtversicherung, die eine mögliche zukünftige Pflegebedürftigkeit sozial absichern soll. Träger der gesetzlichen Pflegeversicherung sind die Pflegekassen. Sie sind jeweils unter dem Dach der entsprechenden Krankenkassen angesiedelt. Gesetzlich Krankenversicherte zahlen einen Beitrag an ihre Pflegekasse, der vom Einkommen abhängig ist. Privat Versicherte müssen eine private Pflegeversicherung abschließen.
Wer erhält Leistungen der Pflegeversicherung?
Anspruch auf Leistungen der Pflegeversicherung haben Menschen, die pflegebedürftig im Sinne des Elften Buches des Sozialgesetzbuches (SGB XI) sind. Vor der Inanspruchnahme von Leistungen der Pflegeversicherung müssen Versicherte einen Antrag bei ihrer Pflegekasse stellen.
Wer ist pflegebedürftig?
Pflegebedürftig sind Menschen, die körperliche, kognitive bzw. psychische Beeinträchtigungen oder gesundheitlich bedingte Belastungen oder Anforderungen nicht selbständig kompensieren bzw. bewältigen können und deshalb der Hilfe anderer bedürfen.
Wie errechnet sich der jeweilige Pflegegrad?
Wie wird Pflegebedürftigkeit festgestellt (Antragstellung)?
Häusliche Pflege
Pflegebedürftigkeit wird also nicht daran gemessen, wie schwer jemand erkrankt oder beeinträchtigt ist. Ausschlaggebend ist vielmehr, wie stark die Betroffenen in ihrer Selbständigkeit eingeschränkt sind. Im Mittelpunkt stehen folgende Fragen:
- Wie selbständig ist der Mensch bei der Bewältigung seines Alltags?
- Welche Aktivitäten können eigenständig durchgeführt werden?
- Bei welchen Aktivitäten wird die Unterstützung anderer Personen benötigt?
Im Gesetz sind sechs Bereiche (auch Module genannt) definiert, die für die Bewältigung des täglichen Lebens wesentlich sind. Dies sind:
- Mobilität,
- Kognitive und kommunikative Fähigkeiten,
- Verhaltensweisen und psychische Problemlagen,
- Selbstversorgung,
- Bewältigung von und selbständiger Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen und Belastungen,
- Gestaltung des Alltagslebens und soziale Kontakte.
Im Rahmen der Pflegebegutachtung wird festgestellt, ob in diesen sechs Bereichen eine Beeinträchtigung der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten vorliegt und wie stark diese ausgeprägt ist.
Die Beeinträchtigung der Selbständigkeit bzw. der Fähigkeiten muss außerdem „auf Dauer“ bestehen, also voraussichtlich für mindestens sechs Monate.
Je nach Schwere der Beeinträchtigungen werden pflegebedürftige Menschen einem von fünf Pflegegraden zugeordnet.
Wie errechnet sich der jeweilige Pflegegrad?
Die Zuordnung zu einem Pflegegrad erfolgt anhand eines Punktesystems. Dazu werden in den sechs o. g. Lebensbereichen die Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten festgestellt. Zu jedem Bereich werden im Rahmen der Begutachtung mehrere Einzelkriterien betrachtet. Für jedes Einzelkriterium werden Punkte vergeben. Die Höhe der Punkte orientiert sich daran, wie sehr die Selbstständigkeit eingeschränkt ist. Je schwerwiegender die Beeinträchtigung ist, desto höher ist die vergebene Punktzahl. Die innerhalb eines Bereiches für die verschiedenen Kriterien vergebenen Punkte werden zusammengezählt und gewichtet. Denn entsprechend ihrer Bedeutung für den Alltag fließen die Ergebnisse aus den einzelnen Bereichen unterschiedlich stark in die Berechnung des Pflegegrades ein. Beispielsweise der Bereich „Selbstversorgung“ mit 40 Prozent oder der Bereich „Mobilität“ mit 10 Prozent. Die gewichteten Punkte der Module werden dann zu einem Gesamtpunktwert addiert. Aus dem Gesamtpunktwert wird das Ausmaß der Pflegebedürftigkeit bestimmt und der Pflegegrad abgeleitet. Eine Besonderheit besteht darin, dass nicht beide Werte der Bereiche 2 (kognitive und kommunikative Fähigkeiten) und 3 (Verhaltensweisen und psychische Problemlagen) in die Berechnung eingehen, sondern nur der höchste der beiden gewichteten Punktwerte.
Pflegebedürftigkeit liegt vor, wenn der Gesamtpunktwert mindestens 12,5 Punkte beträgt. Der Grad der Pflegebedürftigkeit bestimmt sich wie folgt:
Pflegegrad 1: 12,5 bis unter 27 Punkte (geringe Beeinträchtigung der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten),
Pflegegrad 2: 27 bis unter 47,5 Punkte (erhebliche Beeinträchtigung der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten),
Pflegegrad 3: 47,5 bis unter 70 Punkte (schwere Beeinträchtigung der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten),
Pflegegrad 4: 70 bis unter 90 Punkte (schwerste Beeinträchtigung der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten),
Pflegegrad 5: 90 bis 100 Punkte (schwerste Beeinträchtigung der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten mit besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung).
Pflegebedürftige Kinder im Alter bis zu 18 Monaten werden pauschal einen Pflegegrad höher eingestuft. Pflegebedürftige, die einen spezifischen, außergewöhnlich hohen personellen Unterstützungsbedarf mit besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung aufweisen, werden unabhängig vom Erreichen des Schwellenwertes von 90 Punkten dem Pflegegrad 5 zugeordnet. Diese sogenannte besondere Bedarfskonstellation liegt nur beim vollständigen Verlust der Greif-, Steh- und Gehfunktionen vor.
Wie wird Pflegebedürftigkeit festgestellt (Antragstellung)?
Zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit muss ein Antrag bei der Pflegekasse gestellt werden. Die Pflegekasse gehört zur Krankenkasse. Wird ein Pflegeantrag gestellt, lassen alle Pflegekassen durch den Medizinischen Dienst (MD) oder durch einen anderen von der Pflegekasse beauftragten Gutachter prüfen, ob die Voraussetzungen der Pflegebedürftigkeit erfüllt sind und welcher Pflegegrad vorliegt. Dies geschieht in der Regel durch einen zuvor angemeldeten Hausbesuch einer Pflegefachkraft oder eines Arztes.
Der Gutachter stellt bei seinem Besuch die Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten in den sechs oben vorgestellten Bereichen fest. Die notwendigen Informationen erhält der Gutachter durch das Gespräch mit der Antragstellerin bzw. dem Antragsteller und seinen Pflegepersonen sowie durch die Auswertung vorliegender Fremdbefunde (wie zum Beispiel die Pflegedokumentation, Krankenhaus- oder Arztberichte und das Pflegetagebuch) und nicht zuletzt durch eine körperliche Begutachtung. Der Gutachter empfiehlt der Pflegekasse die Zuordnung zu einem Pflegegrad. Die Kasse trifft umgehend eine Entscheidung und übermittelt dies mit einer Kopie des Gutachtens an den Pflegebedürftigen.
Leistungen der Pflegeversicherung
Wovon ist der Anspruch auf Leistungen abhängig?
Der Anspruch auf Leistungen in der Pflegeversicherung ist davon abhängig, welcher Pflegegrad vorliegt und wie die Person versorgt wird (im eigenen Zuhause oder in einer Pflegeeinrichtung).
Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 haben Anspruch auf alle Leistungen der Pflegeversicherung. Die Höhe des Leistungsanspruches ist abhängig vom Pflegegrad. Je höher der Pflegegrad, desto höher sind auch die Leistungen.
Pflegebedürftige des Pflegegrades 1 haben nur einen eingeschränkten Leistungsanspruch, da bei ihnen die Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit nur gering sind. Bei diesem Personenkreis stehen der Erhalt der Selbstständigkeit und die Vermeidung schwerer Pflegebedürftigkeit im Vordergrund. Die Leistungen dienen der Stabilisierung des häuslichen Pflegearrangements.
Häusliche Pflege
Pflegebedürftige können bei häuslicher Pflege wählen zwischen Pflegesachleistungen, Pflegegeld und einer Kombination dieser Leistungen.
Angebote zur Unterstützung im Alltag (Hilfe im Haushalt, Einzelbetreuung oder in Gruppen)
Entlastungsbetrag
Pflegesachleistungen
Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 haben bei häuslicher Pflege Anspruch auf körperbezogene Pflegemaßnahmen, pflegerische Betreuungsmaßnahmen und Hilfen bei der Haushaltsführung als Sachleistung (häusliche Pflegehilfe) durch einen Pflegedienst. Leistungen der häuslichen Pflege sind auch zulässig, wenn Pflegebedürftige nicht in ihrem Haushalt gepflegt werden (zum Beispiel bei ihren Angehörigen); sie sind nicht zulässig, wenn Pflegebedürftige in Pflegeeinrichtungen gepflegt werden.
Die Pflegesachleistung beträgt je Kalendermonat:
Für Pflegebedürftige des Pflegegrades 2: 761 €
Für Pflegebedürftige des Pflegegrades 3: 1.432 €
Für Pflegebedürftige des Pflegegrades 4: 1.778 €
Für Pflegebedürftige des Pflegegrades 5: 2.200 €
Pflegegeld für selbst beschaffte Pflegehilfen
Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 können anstelle der häuslichen Pflegehilfe ein Pflegegeld beantragen. Der Anspruch setzt voraus, dass der Pflegebedürftige mit dem Pflegegeld - dessen Umfang entsprechend - die körperbezogenen Pflegemaßnahmen, die pflegerischen Betreuungsmaßnahmen und die Hilfen bei der Haushaltsführung in geeigneter Weise, zum Beispiel durch einen Angehörigen, selbst sicherstellt.
Das Pflegegeld beträgt je Kalendermonat:
Für Pflegebedürftige des Pflegegrades 2: 332 €
Für Pflegebedürftige des Pflegegrades 3: 573 €
Für Pflegebedürftige des Pflegegrades 4: 765 €
Für Pflegebedürftige des Pflegegrades 5: 947 €
Kombination von Geld- und Sachleistung
Nehmen Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 die ihnen zustehenden Sachleistungen nur teilweise in Anspruch, erhalten sie daneben ein anteiliges Pflegegeld.
Häusliche Pflege bei Verhinderung der Pflegeperson
Ist die Pflegeperson wegen Erholungsurlaubs, Krankheit oder aus anderen Gründen an der Pflege gehindert, übernimmt die Pflegekasse die Kosten einer notwendigen Ersatzpflege für längstens sechs Wochen und bis zu 1.612 Euro je Kalenderjahr. Voraussetzung ist, dass die Pflegeperson den Pflegebedürftigen vor erstmaliger Verhinderung mindestens sechs Monate in seiner häuslichen Umgebung gepflegt hat und der Pflegebedürftige zum Zeitpunkt der Verhinderung mindestens in Pflegegrad 2 eingestuft war. Die Verhinderungspflege kann durch Nachbarn oder durch einen ambulanten Pflegedienst übernommen werden – bei Angehörigen als Leistungserbringer gelten andere Beträge.
Es besteht die Möglichkeit, jährlich 806 Euro von der Kurzzeitpflege auf die Verhinderungspflege zu übertragen. D. h. insgesamt stehen dann 2.418 Euro für die Verhinderungspflege zur Verfügung.
Angebote zur Unterstützung im Alltag (Hilfe im Haushalt, Einzelbetreuung oder in Gruppen)
Menschen, die in der Häuslichkeit gepflegt werden, können zusätzlich zur Pflegesachleistung bzw. dem Pflegegeld Angebote zur Unterstützung im Alltag in Anspruch nehmen. Angebote zur Unterstützung im Alltag tragen dazu bei, Pflegepersonen zu entlasten und sollen Pflegebedürftigen helfen, möglichst lange in ihrer häuslichen Umgebung zu bleiben und soziale Kontakte aufrecht zu erhalten.
Die Angebote werden unterschieden in
Betreuungsangebote,
Angebote zur Entlastung von Pflegenden,
Angebote zur Entlastung im Alltag (zum Beispiel haushaltsnahe Dienstleistungen).
Die Angebote benötigen eine Anerkennung durch die jeweils zuständige Behörde nach Maßgabe des jeweiligen Landesrechts. Die Leistungen unterscheiden sich daher von Bundesland zu Bundesland. Klären Sie im Zweifelsfall direkt mit Ihrer Pflegekasse, ob eine bestimmte Leistung erstattet wird.
Für die Nutzung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag steht der Entlastungsbetrag (s. u.) zur Verfügung. Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 können zudem bis zu 40 v. H. des Sachleistungsbetrages für Angebote zur Unterstützung im Alltag nutzen. Die Umwandlung der nicht genutzten Pflegesachleistung für eine Entlastungsleistung ist ohne Antrag bei der Pflegekasse möglich.
Entlastungsbetrag
Pflegebedürftige erhalten einen Entlastungsbetrag von 125 Euro monatlich (also bis zu 1.500 Euro im Jahr), den Sie für
Pflegeberatung
- Tages- und Nachtpflege,
- Kurzzeitpflege,
- ambulante Pflegedienste (in den Pflegegraden 2 bis 5 jedoch nicht für Leistungen im Bereich der Selbstversorgung (Hilfe im Haushalt oder Betreuung),
- Angebote zur Unterstützung im Alltag
einsetzen können.
Soweit der monatliche Leistungsbetrag in einem Kalendermonat nicht (vollständig) ausgeschöpft worden ist, wird der verbliebene Betrag jeweils in die darauffolgenden Kalendermonate übertragen. Leistungsbeträge, die am Ende des Kalenderjahres noch nicht verbraucht worden sind, können noch bis zum Ende des darauffolgenden Kalenderhalbjahres übertragen werden.
Um die Kostenerstattung für die entstandenen Aufwendungen zu erhalten, müssen bei der Pflegekasse jeweils Belege eingereicht werden. Aus den eingereichten Belegen und dem Antrag auf Erstattung der Kosten muss dabei hervorgehen, im Zusammenhang mit welchen der oben genannten Leistungen (Leistungen der Tages- oder Nachtpflege, Leistungen der Kurzzeitpflege, Leistungen ambulanter Pflegedienste oder/und Leistungen nach Landesrecht anerkannter Angebote zur Unterstützung im Alltag) den Pflegebedürftigen Eigenbelastungen entstanden sind und in welcher Höhe dafür angefallene Kosten aus dem Entlastungsbetrag erstattet werden sollen.
Pflegeberatung
Versicherte, die Leistungen der Pflegeversicherung erhalten, haben gegenüber der Pflegekasse einen gesetzlichen Anspruch auf Pflegeberatung durch speziell ausgebildete Pflegeberaterinnen und Pflegeberater. Gleiches gilt für Versicherte, die zwar noch keine Leistungen der Pflegeversicherung erhalten, aber einen Antrag auf Leistungen gestellt haben und bei denen erkennbar ein Hilfe- und Beratungsbedarf besteht. Auch pflegende Angehörige und weitere Personen, zum Beispiel ehrenamtliche Pflegepersonen, haben einen eigenständigen Anspruch auf Pflegeberatung. Voraussetzung hierfür ist die Zustimmung der Pflegebedürftigen.
Quelle: Fragen & Antworten vom vdek Die Ersatzkassen | Der Pflegelotse
Pflegestützpunkte
Anspruchsberechtigte können die Pflegeberatung auch in einem Pflegestützpunkt wahrnehmen. In einem Pflegestützpunkt werden die Beratung und die Vernetzung aller pflegerischen, medizinischen und sozialen Leistungen gebündelt. Der Pflegestützpunkt bildet das gemeinsame Dach, unter dem sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pflege- und Krankenkassen, der Altenhilfe und der Sozialhilfeträger untereinander abstimmen und Hilfe Suchenden ihre Sozialleistungen erläutern und mit Rat zur Seite stehen.
Verpflichtende Beratungsbesuche bei Bezug von Pflegegeld (§ 37 Abs. 3 SGB XI)
Pflegebedürftige, die ausschließlich Pflegegeld beziehen, müssen gemäß § 37 Abs. 3 SGB XI in den Pflegegraden 2 und 3 einmal halbjährlich sowie in den Pflegegraden 4 und 5 einmal vierteljährlich eine Beratung in der eigenen Häuslichkeit in Anspruch nehmen. Der Beratungsbesuch in der eigenen Häuslichkeit dient der Sicherung der Qualität der häuslichen Pflege sowie der regelmäßigen praktischen pflegefachlichen Unterstützung der häuslich Pflegenden.
Die Beratungsbesuche können durch ambulante Pflegedienste, anerkannte Beratungsstellen, Pflegeberaterinnen und Pflegeberater der Pflegekassen und Beratungspersonen der kommunalen Gebietskörperschaften mit der erforderlichen pflegefachlichen Kompetenz durchgeführt werden.
Quelle: Fragen & Antworten vom vdek Die Ersatzkassen | Der Pflegelotse
Lassen Sie sich von uns kompetent beraten!